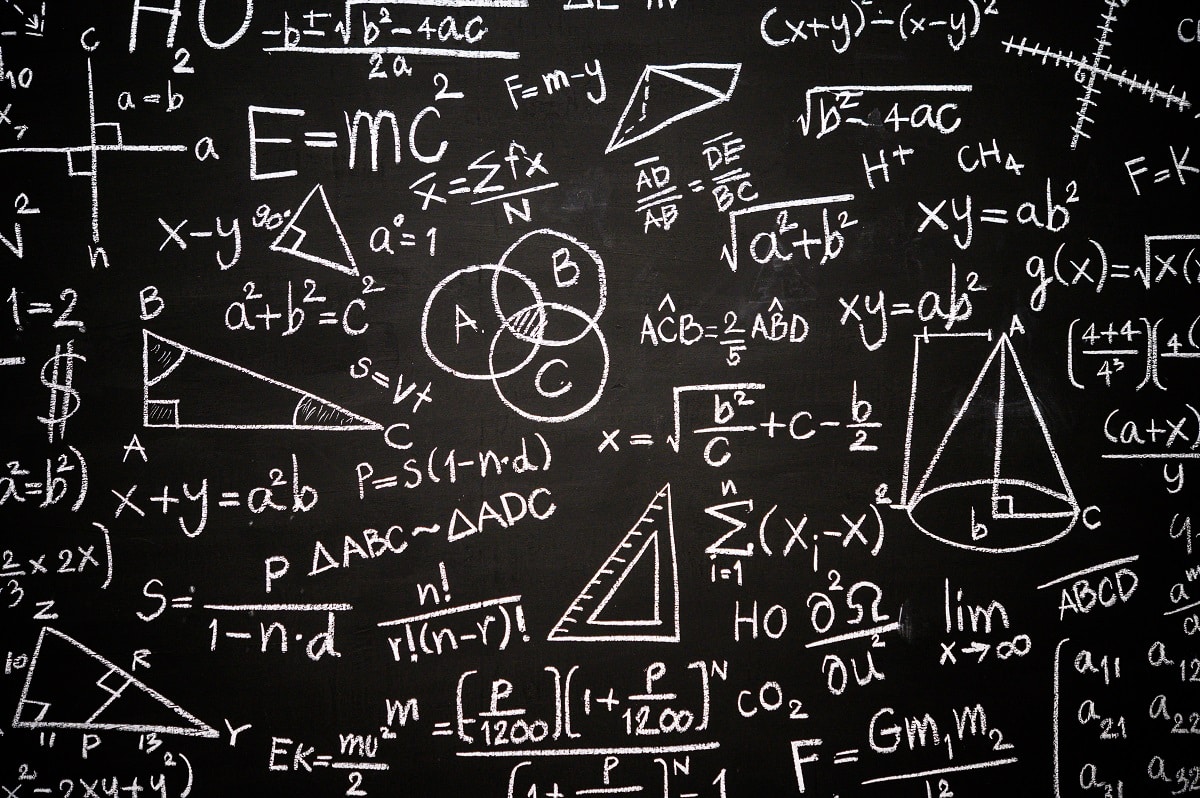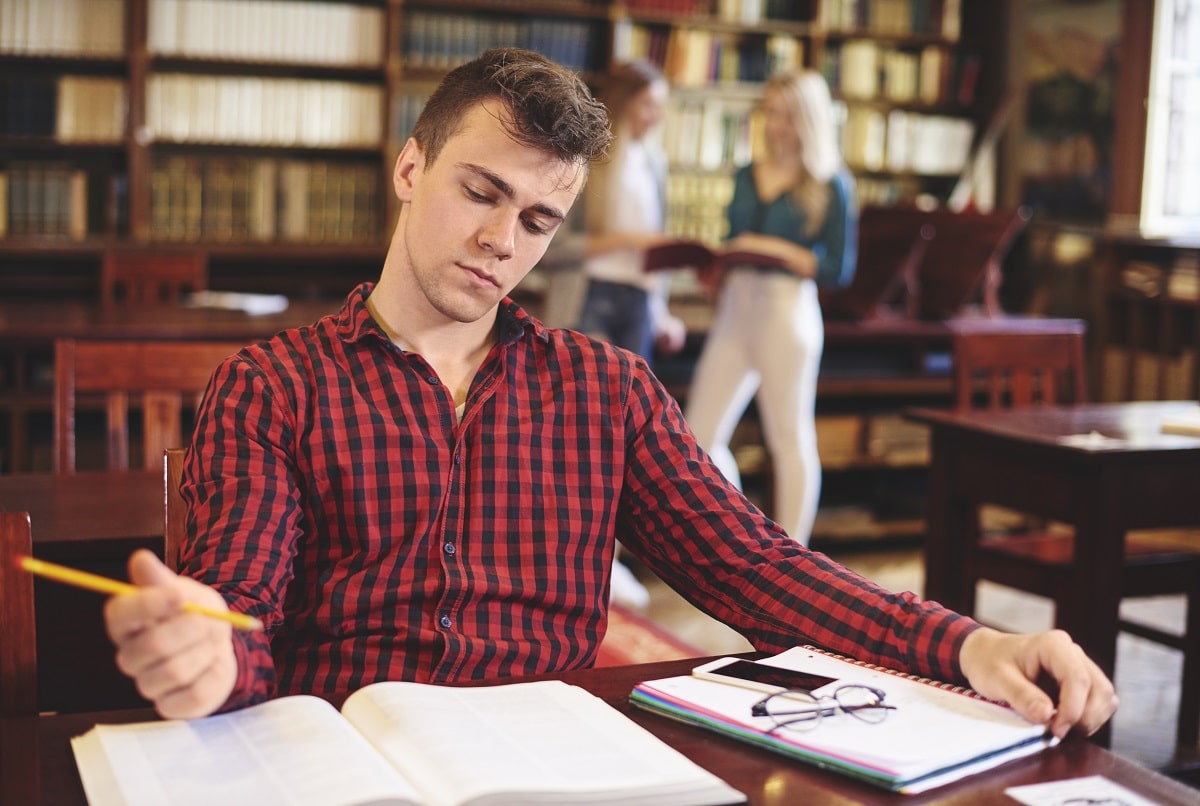Es ist traurige Realität, dass ein Drittel aller Ukrainer*innen zurzeit wegen des barbarischen Überfalls durch Russland auf der Flucht ist. Das schließt auch Schüler*innen ein, die normalerweise kurz vor Beginn ihres Studiums stehen würden.
Damit sie nach dem hoffentlich bald einkehrenden Frieden in ihrer Heimat ihr Studium direkt anfangen oder fortsetzen können, haben vor kurzem mehrere deutsche Hochschulen ihre Räume und Infrastruktur für standardisierte Hochschulzugangstests zur Verfügung gestellt. Dazu zählte die Berliner Humboldt-Universität, die Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie die Universitäten Hamburg, Leipzig und Köln. In München wurde das Kulturzentrum „Gorod“ von dem ukrainischen Ministerium für Bildung und Wissenschaft selbst gewonnen.
Dr. Tobias Kunstein, Leiter des Rektoratsstabes der Uni Köln, erzählte uns in einem persönlichen Gespräch wie das Ganze ablief, welche Herausforderungen die Aktion mit sich brachte und woher die vielen freiwilligen Helfer*innen kamen.

Tobias Kunstein: Das ukrainische Bildungs- und Wissenschaftsministerium ist auf das deutsche Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zugegangen, die sich an die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gewendet haben.
Es haben sich insgesamt sechs deutsche Universitäten auf den Aufruf gemeldet. Vermutlich wollte man wegen der Übersicht nur mit größeren Unis kooperieren. Außerhalb der Ukraine gab es 25.000 Schüler*innen, die diese Zulassungsprüfung ablegen wollten. Diese Zahl verteilt sich auf 23 Länder. Der größte Teil befand sich in der EU, aber einige sogar in Kanada.
Der Vorsitzende der HRK hat Herrn Freimuth, den Rektor der Uni Köln, kontaktiert. So kam die Anfrage, ob wir PC-Pools für ukrainische Hochschulzugangsprüfungen bereitstellen können, zu mir.
CC: Wie habt ihr denn die ukrainischen Schüler*innen kontaktiert?
Kunstein: Die Unis haben die Höhe der verfügbaren Plätze in ihren PC-Pools sowie die passenden Tage zurückgemeldet. Nach einigen Wochen kam dann eine Antwort, wann wie viele Prüflinge betreut werden sollen. Die Kommunikation mit den Schüler*innen selbst lief über das ukrainische Bildungsministerium. Wie es im Einzelnen funktioniert hat, weiß ich gar nicht.
Wir haben hier unsere Vorbereitungen getroffen und am Prüfungstag ab sieben Uhr morgens losgelegt.
CC: Rund 40 Freiwillige, teilweise mit Ukrainisch-Kenntnissen, haben dabei geholfen. Woher kamen diese Menschen?
Kunstein: Das war tatsächlich der größte Teil der Vorbereitungen auf unserer Seite. Die PC-Pools gab es ja schon. Und spätestens seit der Pandemie bestand die Möglichkeit, mit der E-Learning-Plattform ILIAS Prüfungen durchzuführen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage danach stark gestiegen.
Wir haben uns Gedanken darum gemacht, wie breit wir die Helfenden streuen sollten. Denn eigentlich wollten wir das Ganze möglichst universitätsnah belassen. Das war etwas schwierig. Wir wussten aber nicht, wer an der Uni Köln überhaupt Ukrainisch sprechen konnte.
Wir sind also einen Mittelweg gegangen und haben über das International Office der Uni Köln durch eine Umfrage nach Ukrainisch sprechenden Studierenden gesucht. Besonders die ukrainische Hochschulgruppe hat uns da geholfen.
CC: Es gibt eine ukrainische Hochschulgruppe in Köln?
Kunstein: An jeder Universität gibt es Gruppen, in denen sich Studierende unterschiedlicher Nationalitäten zusammenschließen. Die ukrainische Gruppe an der Kölner Uni gibt es schon länger, auch wenn ich nicht genau weiß, wie lange. Von ihnen haben sich einige auf unseren Aufruf gemeldet. So sind wir am Ende bei 40 Freiwilligen angelangt. Sie haben sich jeweils um 1-2 Schüler*innen gekümmert, denn so eine Prüfung ist mit einem relativ großen Zeitaufwand verbunden. Viele waren aber auch fast die ganze Zeit dabei.
Gerade in den ersten Prüfungsdurchläufen waren Menschen, die Ukrainisch sprechen konnten, natürlich Gold wert. Wir konnten uns zur Not aber auch mit „Händen und Füßen“ ganz gut verständigen.
CC: Was waren denn da die besonderen Herausforderungen?
Kunstein: Die größte Hürde war aus meiner Sicht, dass wir die Daten erst um sieben Uhr morgens am Prüfungstag selbst hatten. Um neun Uhr ging die Prüfung schon los. Da mussten wir also schnell organisieren. Zum Beispiel mussten alle 140 Prüflinge eine Karteikarte mit ihren Daten ausgehändigt bekommen. Wir haben also erst einmal so schnell wie möglich 140 Zettel ausgeschnitten. Klingt einfach, war aber auch stressig.
Nach dem ersten Tag wussten wir jedoch, was auf uns zukommt und waren entspannter. Nachdem wir das ukrainische Portal einmal verstanden hatten, ging es auch ohne Übersetzer*innen.
CC: Diese Prüfung berechtigt die Schüler*innen zu einem Studium IN der Ukraine. Gab es auch Anfragen zu einem Studium in Deutschland?
Kunstein: Ja, die hat es gegeben. Kurioserweise auch von vielen Deutschen. Die Prüflinge kamen oftmals in Begleitung ihrer Gastfamilien, bei denen sie zurzeit untergekommen sind. Von denen hat es viele Fragen in diese Richtung gegeben. Wir konnten es teilweise beantworten, da einige Freiwillige aus dem International Office kamen.
Aber das Ganze ist auch nicht in zwei Sätzen zu erklären. Für Nicht EU-Bürger*innen ist es recht aufwendig in Deutschland zu studieren. Man muss eine Art Vorstudium machen, Deutschkurse nachweisen, es gibt Quoten und so weiter. Wer sich dafür interessiert, sollte sich vom International Office beraten lassen.
CC: Werden solche Aufnahmeprüfungen jetzt regelmäßig durchgeführt, oder war es eine einmalige Sache?
Kunstein: Das wissen wir zurzeit nicht.
Es gibt jedenfalls Möglichkeiten zu einer Nachholprüfung. Wenn man den Termin verpasst hat oder Ähnliches. Die Leute wurden sehr eigenwillig verteilt. Wenn man beispielsweise in Köln gewohnt hat, hieß es nicht, dass man auch hier die Prüfung absolvieren konnte. Wir hatten auch Prüflinge aus anderen Bundesländern vor Ort. Ich vermute, dass darauf nicht bei der Verteilung geachtet wurde. Vielleicht wusste man auch nicht, wo die Leute gelandet sind.
CC: Vielen Dank für das Gespräch!